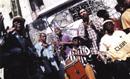Afrika in der kubanischen Musik
In der kubanischen Volksmusik – einer Mischung aus afrikanischen und euroasiatischen Elementen – überwiegten die Ersten, weil die Bevölkerung afrikanischen Ursprungs jahrhunderterlang die grundlegende „folk“-Schicht unserer Gesellschaft war.
In der Zeit, als das kubanische Nationalgefühl sich herausbildete, stellte dieser Teil der Bevölkerung mehr als die Hälfte der Gesamteinwohnerzahl auf der Insel dar. Jahrhunderterlang kontrollierte er den Beruf des Musikers - eine der wenigsten Möglichkeiten sozialen Aufstiegs, die die freien Menschen afrikanischen Ursprungs in der kolonialen Sklavenhaltergesellschaft hatten.
„Schwarzen und Mulatten waren die großen Schmiede der kubanischen Volksmusik und die Verantwortlicher für ihren afrikanischen Charakter“, schrieb Fernando Ortiz, der „dritter Entdecker Kubas“ und einer der großen Kulturwissenschaftler auf dieser Karibikinsel.
Jede Musik ist von sozialer Bedeutung; sie erhält von der Gesellschaft ihre Stimmen, Instrumente, Klanfarben, Töne, Rhythmen, Melodien, Genres und Stile, und nur in der Gesellschaft findet sie ihre menschliche Resonanz. Die Kunst der Schwarzen ist ganz von einem sozialen Gefühl durchdrungen. Schwarzen aus den verschiedensten afrikanischen Völkergruppen beeinflussten die Musik und den Tanz, den Sprachgebrauch und die Volkskunst auf der Insel.
Aus Westafrika insbesondere aus Dahome, Guinea, Ghana, dem vom Volk der Yoruba errichteten Reich der Oyo sowie aus dem Gebiet der Bantu-Völker kamen schwarze Sklaven, deren Gesamtzahl auf der Insel sich bereits im Jahre 1774 auf über 50 000 belief. Fernando Ortiz vermutet, dass im 18. Jahrhundert die offizielle Feierlichkeiten zum Fronleichnamsfest mit dem Auftritt von Gruppen schwarzer Afrikaner ergänzt wurden, die in ihren typischen Trachten auf den Straßen sangen und tanzten.
Was die Beschreibung der folkloristischen Musikrichtungen angeht, war die Zeit um 18. Jahrhundert eine dürre Landschaft. Der Einfluss der rituellen Musik der Schwarzen gelangt in die Tanzsäle mit dem Trommel – Kult- und Anbetungsgegenstand für einige Menschen, profaniert und verboten von anderen; Bote der Götter und Verkörperung der Ahnen in der Religion der Schwarzen auf Kuba; häufig von den damaligen reaktionären und rassistischen Behörden geraubt und zerstört. Das Schicksal der Trommel lief parallel zu dem des Schwarzen, ihr Schöpfer par excellence. Niemand sonst hat gewusst, ihr die tellurische Kraft der Musik
abzugewinnen. Mit dem Klangreichtum der Trommel afrikanischen Ursprungs verglichen, wiesen die die aus Spanien kamen, eine offensichtliche Armut. Einen Platz innerhalb der populären Musik konnten die Letzten erst in Tänzen in der Art der Congas und Comparasas finden, wenn die Spielweise sozusagen afrikanisiert wurde. 1794 erschient eine Romance , in der einen Tanz beschrieben und bereits eine kubanische Form des Contredanse erwähnt wird. Komponisten der Volksmusik profilierten sich in dieser Zeit. Einer von ihnen, ein mittelloser Schwarzer aus Havanna, komponierte Unterhaltungsmusik, sowie Contradanzas und Danzas, was für eine Entwicklungsetappe der kubanischen Musik spricht. Von schwarzen Komponisten geschaffene Contradanzas und Danzas wiesen eine neue Nuancierung auf. Der Danzón entstand aus den französischen Contredanse und Danse im Labor des Theaters typisch kubanischen Zuschnitts und aus der Inspiration von Komponisten wie Buelta, Flores, Faílde und Valenzuela, die die Tanzbedürfnisse in den Ballsälen, der Stadt und den ländlichen Gegenden erfüllten.
Das kubanische Folkloreerbe besteht aus unterschiedlichen Integrationselementen und verschiedenartigen Formen, die von afrikanischen, spanischen und haitianischen Überlieferungen bis hin zu völlig verfeinerten Formen reichen, die wie der Danzón und die Rumba (Guangancó, Yambú und Columbia) neben dem Lyrismus der italienischen Oper und des Musiktheaters den ausgebogenen Beitrag dieser drei Wurzeln aufweisen. Entwickelt sich der Son aus Havanna und den östlichen Provinzen und erreicht er seinen Höhepunkt in städtischen Gebieten innerhalb bestimmter halbprofessionellen Gruppen (Son-Orchester, Quartette, Sextette und Septette), so ist die Rumba eine ausgesprochene Ausdruckform der schöpferischen Leistung der ärmsten Schichten der bereits kulturell integrierten kubanischen Bevölkerung in den städtischen, vorstädtischen (Yambú und Guangancó) und ländlichen Bezirken (Columbia).
Zweifelsohne liegen die Ursprünge des Kulturphänomens Rumba in den ländlichen Sklavenbaracken und den Mietskasernen (solares) Havannas. Genannt nach einer gleichnamigen ländlichen Ortschaft in der Provinz Matanzas, in der häufig Timba- und Rumbafeste gefeiert werden, ist die Columbia eine Form der Rumba, die in den Sklavenbaracken zur Welt kam. Die Tanzstile Guangancó und Yambú entstanden dagegen in den Mietskasernen Havannas.
Sind die Tänze und Gesänge der Yoruba-, Bantu- und Calabar-Völker künstlerischrituelle Urformen, die die afrikanischen Sklaven auf Kuba aufbewahrten und sogar das katholische Dogma und die Bräuche auf der Insel beeinflussten, so sind die Rumba und ihre Varianten die unmittelbarste Äußerung des profanen oder heidnischen Musikschaffens des Volkes.
Ländlichen Ursprungs und daher primitiver und melodisch-literarisch weniger entwickelt, lässt die Columbia jedoch gewisse klägliche Akzente spüren, die in bestimmten Kongo-Gesängen (Yuca oder Macuta, Juegos de Maní) sehr charakteristisch und noch in mehreren Gebieten der Provinz Matanzas hörbar sind. Obwohl sich das teatro bufo in Havanna fast alle künstlerische Äußerungen und vom Volk geschaffene Charaktertypen aneignete, trug es auch beträchtlich dazu bei, dieses für das Volk typische Schaffen stereotyp zu verwenden. Die künstlerische Auffassung und die Darstellungsform dieses Theaters waren von der ursprünglichen Physiognomie des Volks insbesondere in der Choreografie ziemlich entfernt.
Rumba, Danza und Contradanza Bis in unsere Tage hinein - und dank des Theater einheimischen Kolorits – hat man in den Bereichen des kommerziellen Kabaretts, Kinos und Fernsehens, sowohl auf Kuba als auch im Ausland, eine falsche sogar unverschämte Auffassung über die musikalische, literarische und choreografische Physiognomie der ursprünglichsten musikalischtänzerischen Äußerung des kubanischen Folkloreerbes: die Rumba. Eine pantomimische Darstellung eines Hahns und einer Henne, bei der diese graziös mit dem Tänzer, der sie zielbewusst und sehr elegant verfolgt, kokettiert, ist von Theaterschaffenden der typisch kubanischen Musikbühne sowie von Rumbatänzern in den Kabaretts, dem Kino und dem Fernsehen in der Auffassung eines elegant sinnlichen Tanzes völlig negativ deformiert worden.
Im Ausland ist diese Deformation in jeder Hinsicht bis zum Extrem getrieben worden. Ohne Kenntnis des Klangs- und choreografischen Aufbaus der Rumba ist es beabsichtigt worden, alle vokale Genres des Liedguts und die gesungenen Tänze der kubanischen populären Musik mit ihr zu identifizieren, denn die Werbung der großen amerikanischen Schallplattenfirmen unter der Etikett „Rumba“ alles verkauft, was in dem Karibikraum produziert wird.
Historisch geht der kubanische Nationaltanz Danzón auf die französische Contradanse zurück. Als Folge der haitianischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts übersiedelten nach Kuba viele französische Siedler mit ihren Familien und Sklaven. Die Mehrheit von ihnen ließ sich in der früheren Provinz Oriente nieder. Bald wurde die Contradanse unter Mitwirkung der Schwarzen in den Orchester auf der Insel kultiviert, angeeignet und sozusagen kubanisiert. Nach kaum zehn Jahren wies sie in der Choreografie und der Musik die charakteristischsten Elemente der volkstümlichen kubanischen Sinnesart. Die Contradanza beherrschte rund dreißig Jahre die Tanzlandschaft, dann kam die kubanische Danza mit identischer Form wie ihre Vorläuferin aber außergewöhnlich reich in der Melodie, dem Rhythmus und der Choreografie. In dieser ersten Etappe der Danza wuchsen die Wurzeln des zukünftigen Danzón.
Miguel Faílde, dessen Dazón „Las alturas de Simpson“ er am 12. August 1879 in dem Club der Stadt Matanzas uraufführte, tat nichts anderes als einen Figurentanz, der zu dieser Zeit sehr populär war, in Musik zu setzen. Diese Komposition von Faílde war einer Gruppe von Freunden und Bewunderern zu verdanken, die ihn um eine Tanzmusik eines langsameren „Tempos“ als des der Contradanza und Danza baten. Die verschiedenen Elemente, mit denen Faílde dazu beitrug, eröffneten eine Form, durch die alle wesentliche Merkmale der Genres, Stilen und Formen, die in der kubanischen Volksmusik sowie in ihren den afrikanischen und spanischen Überlieferungen zusammenkommen, kanalisiert werden konnten.
Guaguancó Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die berühmten Guaguancó-Chöre Paso Franco und Los Roncos in den Stadtvierteln Pilar und Pueblo Nuevo. Diese anerkannten volkstümlichen Chöre, zu denen Männer und Frauen aus der Gesellschaften Abakuá, Coro de Clave, Pendón de Negros Curros, Cabildo Lucumí und Sociedad de Recreo gehörten, lagen jahrelang im Wettstreit miteinander um die Qualität und Schönheit ihrer Gesänge und literarischen Äußerungen. Sie traten in den Höfen der Mietskasernen (La Jacoba, La Siguanea) und an einigen vorstädtischen Bühnen auf.
Der Chor Los Roncos des Stadtviertels Pueblo Nuevo erreichte Popularität in der Zeit, als er unter der Leitung des großen kubanischen Folkloristen Ignacio Piñeiro war. Neben Piñeiro ragten mehrere berühmte Rumbatänzer wie Tomás Perez y Sanguily hevor, wer die Verantwortung für die melodische und literarische Produktion der Gruppe hatte.
Der Chor Paso Franco rechnete mit mehreren angesehenen Rumbatänzern, die in keiner Hinsicht hinter denen der Los Roncos, El Lugareño und El Rápido zurückblieben, um nur einigen der populärsten unter den Kennern und Pflegern des Guagancó Habanero zu nennen.