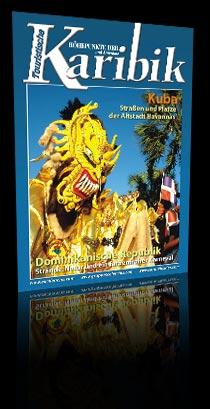Hamelgasse
In dieser berühmten Gasse leben Rastafari und Intellektuelle, Abakuá und Maler, Santero und Musiker, Spirituelle und Japaner in harmonischem Nebeneinander; auch ist sie zum Tempel der Verehrung des afrikanischen Erbes in Kuba geworden.
In Kuba prallt die Sonne um die Mittagszeit unbarmherzig auf die Menschen nieder und brennt auf der Haut wie glühende Kohlen. Und trotzdem herrscht zu dieser Zeit an Sonntagen eine Art Euphorie im Callejón de Hamel. Es scheint, als bildeten die Trommelschläge und der trockene Klang der Claves eine Schutzhülle um die, sich unaufhörlich bewegenden, Körper und Beine, um die Hüften, die sich wiegen und im Rhythmus der besten Rumba bewegen. Bei ausländischen Besuchern, die bereits von dem berühmten Hauptstadtviertel Cayo Hueso mit seiner Hamelgasse gehört haben, löst diese Szene möglicherweise kein Erstaunen aus. Vielleicht wissen sie bereits, dass hier der große Chano Pozo, Freund von Dizzy Gillespie, geboren wurde und aufwuchs; jener Mann, der den Jazz revolutionierte, als er den Klang der Tumbadora-Trommeln einführte. Doch was sie möglicherweise nicht wissen ist die Tatsache, dass, ebenso wie die spanischen Kolonialherren die afrikanische Religion bekämpften - später wurde sie fast ausgelöscht , als sie afrokubanischen Charakter zu tragen begann - auch die Rumba nach und nach aus den Innen- und Hinterhöfen Havannas verschwand. Dass sie heute wieder in neuem Glanz erstrahlt, ist zu einem großen Teil der Beharrlichkeit des Malers und Bildhauers Salvador González Escalona zu verdanken, dessen Werke auf mehreren Kontinenten in Museen und in Privatkollektionen ausgestellt sind. Das ist einer der vielen Gründe, weshalb die Bewohner des Callejón de Hamel den wahren Künstler, der Salvador ohne Zweifel ist, bewundern und achten und in ihren Kalendern den 21. April 1990 als geheiligtes Datum vermerken. Jener Tag markierte den Beginn eines neuen Lebens in dieser wichtigen Kultstätte des Stadtbezirks Centro Habana. Dem soziokulturellen und kommunalen Projekt, umgeben von gigantischen und farbenfrohen Wandgemälden, mit denen Salvador die Bewohner des Callejón beglückt hatte, wurde internationale Anerkennung zuteil. Derzeit ist der Ort eine Kunstgalerie im Freien, an dem die Gemälde nicht an den kalten Wänden eines Museums hängen, sondern im täglichen Zwiegespräch mit den Menschen stehen und die, von den Vorfahren überlieferten Werte einer tausendjährigen Kultur übermitteln, die immernoch so viel mit unserer Identität zu tun hat. Weder die Wandgemälde noch die Installationen des bereits 17-jährigen Projektes sind in der Improvisation entstanden. Die Altäre, mit denen die afrokubanischen Traditionen geehrt werden, sind das Resultat tiefgründiger Studien des Künstlers. Es gibt kein Heute ohne das Gestern. In diesem Bewusstsein hat es Salvador verstanden, sein Wissen nicht für sich alleine zu behalten, sondern mit anderen zu teilen. Daher seine wiederholten Workshops und Vorträge, deren aufmerksamsten Zuhörer die Bewohner des Viertels sind, die wahren Protagonisten des Projektes, das es sich zum Ziel gesetzt hat, sie durch die Kultur zu rechtschaffenden Frauen und Männern zu machen. Als geborener Kulturförderer, machte es sich der Meister zur Gewohnheit, zu den Einweihungen seiner Wandgemälde seine Freunde einzuladen. So kam es, dass Merceditas Valdés, Celeste Mendoza und Compay Segundo, um nur einige zu nennen, die spektakuläre Rumba miterlebten, die Salvador in dieses Wohnviertel zurückgebracht hatte. Und das festigte auch die ständige Präsenz von Theater-, Tanz- und Musikveranstaltungen unterschiedlichster Genres, vom traditionellen Lied bis hin zum Feeling, das hier in dieser Gasse geboren wurde. Salvador ist ohne Zweifel ein wagemutiger Künstler, der in all den Jahren nicht aufgehört hat, ethische, philosophische und wissenschaftliche Werte zu vermitteln und die Kinder, die er im Malen unterrichtet oder mit denen er sich schlicht in der Schule unterhält, die Anerkennung der afrokubanischen Kultur - und damit unserer Identität - zu lehren. Der Callejón de Hamel diente auch als Anregung für weitere kommunale Projekte in Havanna. "Cualquiera se come un ñame" (sinngemäß: ein jeder kann sich täuschen), wie an einem Hoftor zu lesen ist, betrachtet der Besucher die Gasse lediglich als eine Stätte, an der man, ohne Eintritt bezahlen zu müssen, die ansteckende Rumba genießen kann. Doch der Callejón de Hamel ist mehr als ein Ort, an dem Rastafari und Intellektuelle, Abakuá und Maler, Santero und Musiker, Spirituelle und Japaner, US-Amerikaner und Franzosen in harmonischem Nebeneinander leben; daneben ist er für viele zum Lebensmittelpunkt geworden und zum Tempel der Verehrung des afrikanischen Erbes in Kuba.