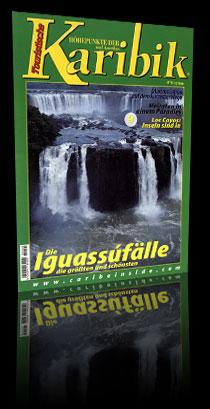Ein Piano im Kreis von Trommeln
Eines schönen Tages verließ Bebo die Probe. Da setzte sich der Junge an das Instrument, schaute auf die Partitur und spielte die dort geschriebenen Noten. Diese Anekdote verewigte sich wie eine jener Legenden, mit denen man das Genie zu beschreiben versucht. Gewiss ist nun, dass der heute 61-jährige Chucho Valdés – ein Alter, das in seiner Person noch als jugendlich gilt – sich noch viele tausend Male ans Klavier zu setzen gedenkt, um das Wunder des Bezauberns zu praktizieren.
Das Maß seines Erfolges zeigt eine Anerkennung, die mehr umfasst als den Latin Jazz oder afrokubanischen Jazz, wie die Verschmelzung des Bebops mit der kubanischen Musik genannt wurde, zu der es Ende der vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts kam, als Dizzy Gillespie, Mario Bauzá und Chano Pozo ihr Talent in New York in einem Dreieck vereinten. In der letzten Rangliste der Zeitschrift Down Beat befindet sich Chucho unter den 12 Kreationspersönlichkeiten des Jahres 2002, und in Interpretation am Piano besetzt er den 6.Platz.
Er ist vierfacher Grammypreisträger: 1979 mit dem Orchester Irakere; 1996 mit dem Orchester Crisol, eine kubanisch-nordamerikanische Band unter Mitleitung des Trompeters Roy Hargrove; 2001 mit Live in the Village Vanguard (Chucho, Piano; Raúl Piñeda, Schlagzeug; Roberto Vizcaíno, kleine und Batá-Trommeln; Francisco Rubio, Bassinstrument und Mayra Caridad Valdés, Gesang) und 2002 den Grammy Latino mit neuen Stücken mit Klavierbegleitung, aufgezeichnet von EGREM in Havanna, nachdem er bereits den Preis Cubadisco in instrumentaler Popmusik erhalten hatte.
Sein Quartett mit dem Bassinstrumentalisten Lázaro Rivero, dem Schlagzeuger Ramsés Rodríguez und dem Trommler Yaroldi Abreu, zu dem sich bei den Auftritten auch seine Schwester Mayra Caridad Valdés gesellte, löste 2002 bei der Zuhörerschaft in Madrid, Barcelona, London, Johannesburg und Kapstadt stürmischen Beifall aus.
Das jüngste Heldenstück des Künstlers wurde mit dem Siegel Blue Note Fantasía Cubana versehen; eine hervorragende musikalische Rundfahrt von Lecuona bis Debussy, bei der Chuchos einzige Ausrüstung die Tasten sind.
Von EXCELENCIAS TURISTICAS DEL CARIBE befragt, sprach der Maestro über die Notwendigkeit einer völligen Hingabe im kreativen Schaffen:
„Man mag noch so viel Talent haben, wesentlich für seine Entwicklung ist das Üben. Übung macht den Meister. Ich hatte doppeltes Glück: zum einen, Sohn eines außerordentlich guten Musikers zu sein und in einem Milieu aufzuwachsen, in dem die Bewunderung und Achtung vor der Musik generell und insbesondere der kubanischen Musik eine feste Regel waren; zum anderen hatte ich das Glück, dass mich meine Lehrer und Dozenten sowohl in Musik unterrichteten als auch die Einstellung lehrten, die man zur Musik haben muss. Ich denke hierbei an Oscar Boufartigue, der mich die Anfangsgründe lehrte; an Zenaida Romeu – jawohl, die Mutter Zenaiditas, der Direktorin des Kammerorchester Camerata Romeu – sowie an Rosario Franco, Tochter eines der vortrefflichsten kubanischen Intellektuellen des vergangenen Jahrhunderts und bedeutendster Kenner des Lebens von Maceo.
Ich glaube, es schon einmal erzählt zu haben“, fährt er fort, „doch was mir Zenaida in der ersten Unterrichtsstunde sagte, stimmt. Sie bat mich, etwas vorzuspielen und ich, der ich mich als den tollen Kerl der schnellen Tempi wähnte, spielte ein rasend schnelles Stück. Sofort sagte sie: „Das ist zwar Fingerfertigkeit, doch keine Musik. Die Musik liegt im Ausdruck. In dieser Richtung werden wir arbeiten.“ Ich übe Tag für Tag viele Stunden. Übe ich einmal einen Tag lang nicht, dann fühle ich mich unwohl.“
Welcher ist nun der Schlüssel des Jazz? Ist es Gedächtnis oder ist es Improvisation? „Ein Jeder hat seine Geheimnisse der Improvisation, die die Seele des Jazz ist. Ausgegangen wird von einem bestimmten Plan, der auf dem Musikthema fußt, denn es geht ja nicht, dass man einfach so drauflos spielt. Ich würde sagen, zum Improvisieren benötigt man drei Dinge: Inspiration, Musikkultur und einen speziellen Sinn für das Erfassen dessen, was dein Umfeld von dir erwartet. Im Falle eines kubanischen Pianisten, der ich bin, musst du wissen, dass es vor dir im Land eine sehr umfassende Geschichte in Bezug auf dieses Instrument gegeben hat. Zur gleichen Zeit, da ich am Klavier sitze und spiele, gibt es in meinem Land und auf der Welt viele andere, die am Kreieren sind. Es geht darum, dass du diese Kultur als etwas ganz Eigenes in dein Naturell einverleibst.“
Einflüsse? Schulden künstlerischer Art? „Ich denke dabei an zu viele Namen als entscheidende Bausteine des kubanischen Jazz. Man muss hier auch sehen, was dahinter steht, denn Lecuona war zwar kein Jazzer, doch sind bei ihm ein Rhythmus und ein Sinn für das Kubanische vorhanden, die man beim Jazz nicht außer Acht lassen darf. Doch stärker noch als die Pianos klingen mir die Schlagzeuge im Ohr, jene Musiker, denen ich, ganz gleich ob sie bekannt sind oder Leute aus dem Volk, starke Aufmerksamkeit widme. Tata gilt meine Bewunderung ebenso wie jenen, die zu Kulthandlungen die Trommeln schlagen. Von allen kann ich lernen. Ich hatte das Glück, meisterhafte Trommler wie Jorge „El Niño“ Alfonso, Miguel Angá, Roberto Vizcaíno und jetzt Yaroldi Abreu in meinen Gruppen zu haben.“
Fühlen Sie sich zur Kultur der Karibik gehörig? „Es ist eine Frage der Identität. Ich bin Kubaner, doch jeder im Bereich der Musik lebenden Kubaner ist eng verbunden mit der Kultur der Karibik. Wir sind eine Einheit von sich kreuzenden Kulturen sowohl auf den frankophonen und anglophonen als auch auf den spanischsprachigen und den Inseln mit kastilischem Dialekt. Unlängst nahm ich am Jazzfestival Gourmed auf Saint Martin teil. Es kamen viele europäische Touristen, um zu erleben, wie diese Volkskulturen der Karibik sich mit dem Jazz vermischen und diesem einen ganz besonderen Anstrich geben.“
Eine spezielle Botschaft für die Leser der Zeitschrift? „Man blicke mit Vertrauen auf die kubanische und die Musik der Völker der Antillen.“