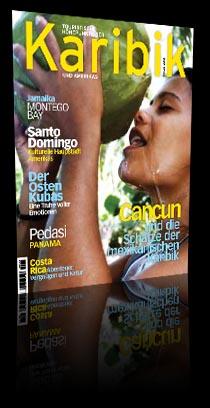Der HutSowohl praktisch als auch ästhetisch
Angefertigt je nach den von Klima und Gewohnheiten diktierten Erfordernissen, kreiert für harte Arbeit und rauhe Witterung oder einfach als ästhetisch-modisches Accesoire, hat er die Menschheit über Jahrhunderte begleitet. Er kommt nicht aus der Mode, gerät nicht in Vergessenheit… Er wird den Umständen angepasst und ist und bleibt beständig.
Ein lateinamerikanischer Schriftsteller bemerkte zum vermeintlich prähistorischen Ursprung der Literatur: Eines Tages schilderte ein Krieger des Stammes, im Schutze des Feuers, den Verlauf der Jagd, und zwischen die realen Fakten flocht er Gebilde seiner eigenen Vorstellung ein. Es könnte damals zu den Anfängen des Hutes – oder zumindest der Idee dazu – gekommen sein, denn es war das erste Mal, dass ein Mann spürte, seine Augen vor der Sonne schützen zu müssen und dann auf ewig den einfachen Umstand entdeckte, dass bei Ausstrecken seiner flachen Hand über der Stirn der von Glanz und Widerschein in den Augen verursachte Schmerz nachließ und, sehr wichtig, seinen Blick in die Weite schärfte. Zu Anfang waren die Hüte natürlich nicht so wie wir sie heute kennen, sondern eher eine Art Kopfputz, von der Umhüllung oder Turban bis hin zum zaghaften Lederhelm, den Tiaras, Birretes, Spitzhüten etc. Als „Idee” gab es den Hut in Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom… Als konkrete Realität, als definierter Gegenstand und stets präsenter Begleiter des Menschen wurde er um das 14. Jahrhundert geboren. An den europäischen Höfen waren jene „Wolkenkratzer” von Hüten zu sehen, voller Zierat und Puder. Doch es gab sie auch einfacher, ebenfalls schöne Kreationen, doch vor allem von längerer Dauer und praktischer, in schlichterem Ambiente, natur- und lebensnah. So verging ein langer Zeitraum bis zum 20. Jahrhundert mit seinen Klassikern wie Dreispitz, Zylinder und Melone. Seitdem begleitet der Hut in vielerlei Formen und aus diversem Material, stereotype Personen und Persönlichkeiten des Films, der Literatur und der Realität; so tragen ihn Charlot, der Revolverheld des amerikanischen Westens, der Gangster der Alkoholprohibition; der mexikanische Charro (Reiter mit bestimmter Tracht), der Krieger der lateinamerikanischen Unabhängigkeit, Indiana Jones, der Bewohner des venezolanischen Flachlandes (Doña Bárbara und Santos Luzardo) oder auch der Gaucho der Pampa, die Femme fatale in der Art der Demonios bajo el Sol oder die provokatorischen Models von Givenchy, Pierre Cardin und Dior. Heute sind es von Mal zu Mal mehr Berühmtheiten, die den Hut sowohl vor als auch hinter den Kulissen tragen, von Brad Pitt bis Eminem, auch Angelina Jolie, Scarlett Johansson und Penélope Cruz. Einige meinen, der Hut sei wieder modern geworden; doch der Wahrheit, der Geschichte und der Würde des Hutes willen wäre es vielleicht richtiger zu sagen, dass einige vom Olymp der Haute Couture und der die Tendenzen bestimmenden Ateliers ihn für gewisse Zeit aus den Augen verloren hatten und nun dabei sind, ihn „wieder zu entdecken”. Denn der Hut war immer da, war Bestandteil unseres Alltags als äußerst praktischer und gelegentlich ästhetischer Gegenstand; sei es nun der Panamahut – ob aus Becal (Campeche, Mexiko) oder aus dem ecuadorianischen Cuenca stammend - , der schöne charaktervolle und prachtvolle Vueltiao aus Kolumbien oder die aus Palmblättern und anderen Pflanzenfasern nach diversen Techniken gefertigten Designs. Nicht zu vergessen die Filz-, Leder-, Stoff-, ja sogar Kunststoffhüte. Es heißt, zur Echtheitsprüfung eines Panamahutes wird dieser geknüllt und durch einen Ring gezogen, und danach lässt man ihn gewähren, bis der Hut wieder seine ursprüngliche Form annimmt, ohne die geringste Falte noch Beschädigung zu zeigen. Es geschieht nahezu wie durch Zauberkraft, wie der Hut über das Szenarium eines Taschenspielers hinaus reagiert. Man beachte, wie er den Händen in Augenblicken der Verlegenheit Hilfsdienste leistet oder wie er als Ausdruck von Euphorie durch die Lüfte fliegt; wie er Stattlichkeit und Würde auszudrücken vermag und mit feiner Eleganz die weiblichen Kurven umkränzt; wie lässt er doch Begehrlichkeit aufflackern, wenn bei Neigung des Kopfes unter seiner Krempe ein Lippenpaar sichtbar wird; wie verbirgt oder enthüllt er Dinge, sich als „Portier” von Erotikspiel und Romanze gebend. Wie hält er doch die Sonne fern und hilft den Augen, den Blick in die Weite zu schärfen.